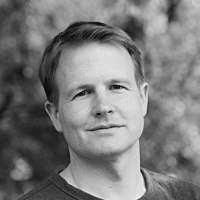Trump macht aus Rent-Seeking Rent-Extraction
Für viele Beobachter in Deutschland schien das Verhältnis zwischen Donald Trump und Tech-Milliardären wie Elon Musk oder Peter Thiel lange klar: Trump ist ein Münzautomat, in den Reiche Geld einwerfen, um politische Gefälligkeiten und Privilegien zu erhalten – klassisches Rent-Seeking. Ein genauerer Blick zeigt jedoch ein komplexeres Wechselspiel zwischen Trump und den Milliardären.
Schon Trumps Selbstgefälligkeit ist unvereinbar mit einer Rolle als Marionette der Tech-Eliten. Der Präsident sieht sich selbst als obersten Strategen und fordert Gefolgschaft ein – von Unterstützern, Unternehmen und Staatschefs. Diese Gefolgschaft zahlt sich für die Unterstützer nicht zwingend aus: Elon Musk etwa bezahlte für sein Engagement für Trump und Doge, neben beträchtlichen Spendengeldern, auch mit Kursrückgängen der Tesla-Aktie.
Sich gegen Trump zu stellen kann aber noch teurer werden. Darauf deuten die Kursverluste von Tesla unmittelbar nach dem über X ausgetragenen Zerwürfnis zwischen Trump und Musk hin. Musks Unternehmen SpaceX ist von staatlichen Aufträgen abhängig, Tesla profitierte stark von Obamas und Bidens Förderungen der Elektromobilität. Ähnlich abhängig sind viele andere große Unternehmen, aber auch viele Länder, für die die USA ein wesentlicher Handelspartner sind und deren Staatschefs nun um Trumps Gunst buhlen müssen.
Aus ökonomischer Sicht ist der zu beobachtende Wettbewerb um die Gunst von Donald Trump Cronyismus mit vertauschten Vorzeichen. Der Ökonom Fred McChesney prägte dafür den Begriff „rent extraction“. Danach reagieren Regierungen nicht nur auf Lobbydruck, sondern setzen ihren diskretionären Entscheidungsspielraum ihrerseits als Druckmittel ein.
In Trumps Zollpolitik zeigt sich Rent-Extraction in Reinform. Unternehmen, die klassisches Rent-Seeking betreiben, hoffen auf Schutzzölle, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Doch die Lieferketten vieler US-Firmen sind so internationalisiert, dass höhere Außenzölle für sie eher eine Bedrohung als ein Schutz darstellen. Die Zölle des „Liberation Day“ treffen nicht einzelne ausgewählte Industrien, sondern wirken als protektionistischer Rundumschlag. Besonders gering ist das Interesse an hohen Zöllen bei Tech-Giganten wie Apple, Sneaker-Marken, Lebensmittelherstellern oder Energieunternehmen. Viele von ihnen suchten bei der Trump-Administration um Ausnahmen nach und verknüpften ihre Bitten mit Investitions- oder Beschäftigungszusagen.
Mit großer Genugtuung präsentiert Trump diese Zusagen der Öffentlichkeit. Es gefällt ihm, Gnade walten lassen – oder den Daumen senken – zu können. So entsteht ein System politischer Knappheit, in dem Konzessionen zu exklusiven Gnadenakten werden. Dieses Vorgehen passt zu Trumps Deal-Denken und war schon in seiner ersten Amtszeit sichtbar: Damals gab es ein formal geregeltes Verfahren, in dem Firmen Ausnahmen von den Strafzöllen auf chinesische Importe beantragen konnten. Eine Studie, die über 50.000 Anträge auf Zollausnahmen aus Trumps erster Amtszeit auswertete zeigt, dass vor allem Unternehmen Ausnahmen erhielten, die den Republikanern nahe stehen. Im Schnitt spendeten Firmen mit genehmigten Anträgen mehr als doppelt so viel an Trumps Partei wie solche, deren Gesuche abgelehnt wurden.
In Trumps aktueller Amtszeit sind die Spielregeln noch intransparenter. Wie Caleb Petitt in seinem lesenswerten Beitrag beschreibt, existiert kein öffentliches Antragsverfahren mehr – wer von Zöllen verschont bleiben will, muss hinter verschlossenen Türen vorstellig werden. Damit hat Trump seine Verhandlungsmacht weiter gesteigert. Für Unternehmen ist es nun noch wichtiger, in Trumps Gunst zu bleiben. Entsprechend steigen die Lobbying-Ausgaben. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 gaben US-Konzerne fast dreimal so viel Geld für Lobbyismus in Handelsfragen aus wie im Vorjahreszeitraum. Diese Mittel fehlen an anderer Stelle, etwa bei Investitionen in effizientere Produktionsverfahren oder neue Produkte.
Für Trump hat der Schwenk vom Adressaten des Rent-Seekings zum Absender der Rent-Extraction mehrere Vorteile: Er ist der starke Mann, der alle Fäden in der Hand hält. Die Zahl der Unternehmen, die auf seine Gunst angewiesen sind, wächst, und selbst Firmen, die keine staatliche Hilfe brauchen, kann er so gefügig machen.
Gesamtgesellschaftlich ist der Schaden der Rent-Extraction jedoch ähnlich groß wie der des klassischen Rent-Seekings: Unternehmen investieren wertvolle Ressourcen in Lobbyarbeit, der offene Wettbewerb um die besten Lösungen weicht dem Wettbewerb um die Gunst des Präsidenten. Wo Ausnahmen und Sonderdeals zur Normalität werden, verlieren Rechtsstaatlichkeit und berechenbare Regeln an Glaubwürdigkeit. Hinzu kommen die Kosten der eigentlichen Zollpolitik, die die internationale Arbeitsteilung empfindlich einschränkt.
Interessant ist, wer sich offen und vor Gericht gegen Trumps Zollpolitik zur Wehr setzt: freche, meist vom unabhängigen Mittelstand finanzierte Organisationen wie das Liberty Justice Center, die Pacific Legal Foundation oder die New Civil Liberties Alliance (NCLA). Von ihnen stammen die Klagen gegen Trumps Zollpolitik – nicht von Walmart, Amazon oder der Chamber of Commerce. So wie sich Rent-Seeking für viele große Unternehmen rechnete, machen sie nun zähneknirschend auch bei der Rent-Extraction mit. Es kommt daher, wie so oft in der politischen Geschichte der USA, auf die Kombination aus einem funktionierenden Rechtsstaat und einem unabhängigen, mit gesunder Staatsskepsis und ökonomischer Expertise ausgestatteten Mittelstand an, um sowohl Rent-Seeking als auch Rent-Extraction eindämmen zu können.